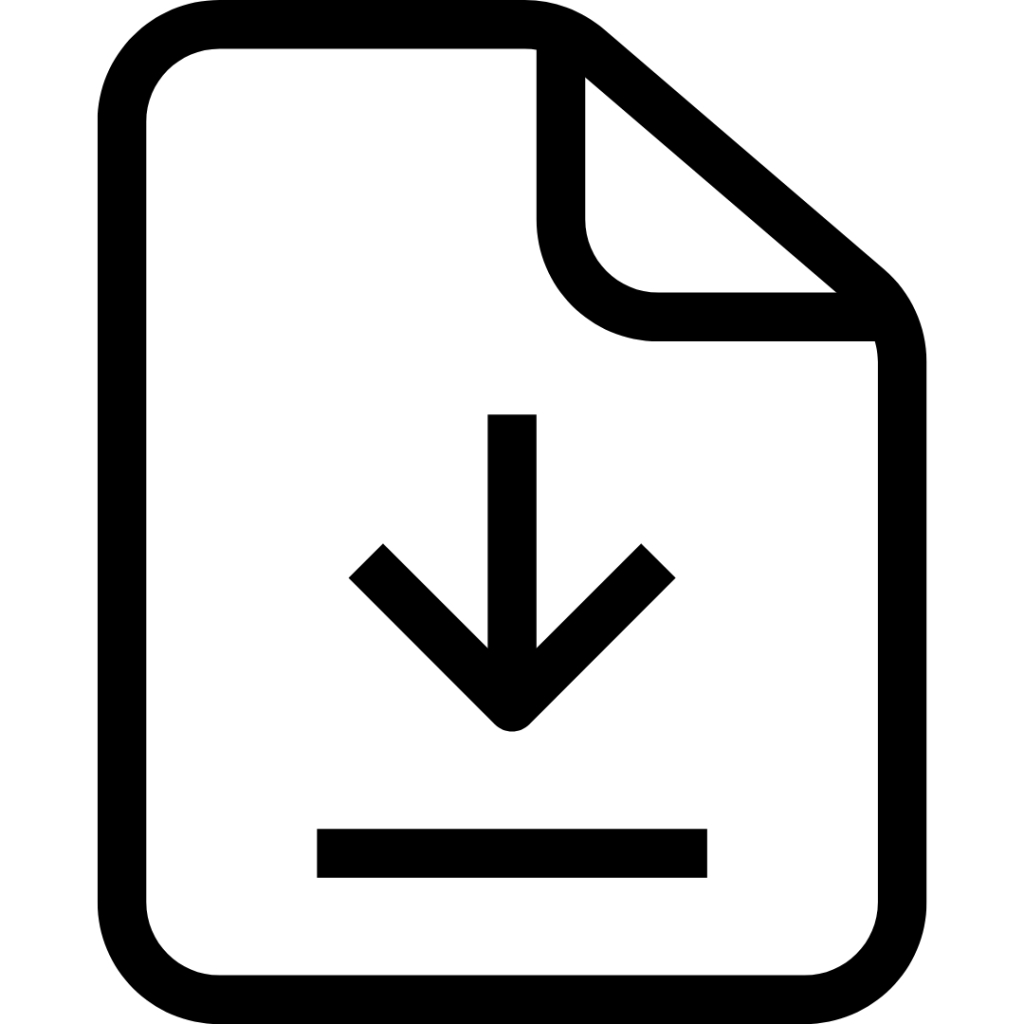Inhalt
Nachwuchs und neue Mitglieder
Viele Ensembles sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern und Nachwuchs. Welche Möglichkeiten gibt es, um neue Gruppen zu erreichen und zu binden, für das Ensemble zu werben und Nachwuchsensembles zu gründen?
Um Nachwuchs für einen Verein oder ein Ensemble zu gewinnen, sollte zunächst die Zielgruppe geklärt werden. Möchten wir Menschen gleichen Alters und gleichen Interesses ansprechen? Möchten wir jüngere Menschen in unser Ensemble einladen? Möchten wir ein jüngeres Ensemble als Sprungbrett für unser Ensemble etablieren? Möchten wir Menschen, die anders sind als wir ansprechen? Was sind Interessen, Bedürfnisse, Wünsche, Orte und Umgangsformen der Zielgruppe? Und wie könnten wir diese Interessen und Bedürfnisse entsprechend bedienen?
Als Neugründungen bieten sich Kinder- und Jugendensembles an, aber auch Gruppenkurse für Familien oder Eltern-Kind-Kurse und Früherziehung. Die Gründungen brauchen einen gewissen organisatorischen Vorlauf: Wer könnte das Ensemble/den Kurs leiten und mit welchem Budget? Gibt es vielleicht ein passendes Förderprogramm, eine Stiftung, einen Kulturverein oder eine Bürgerinitiative? Wo könnte das Ensemble proben? Könnte hierfür mit einer Schule, Musikschule, Kirche oder einem Ort der Jugendlichen kooperiert werden? Auch die Ansprache der Kinder und Jugendlichen kann durch diese Kooperationen erfolgen. Zusätzlich können weitere Werbemaßnahmen in Print (Flyer, Aushänge, Plakate), Online (Soziale Medien, Website) oder Aktionen vor Ort hinzukommen. Nach der Gründung kann das bestehende Ensemble auch regelmäßig mit dem neuen Ensemble zusammenarbeiten, etwa gemeinsam auftreten oder die Kinder und Jugendlichen durch andere Aktionen wie z.B. Moderation, Bilder malen oder tanzen in seine Konzerte miteinbeziehen.
Werbeaktionen für ein bestehendes Ensemble können an Orten der Zielgruppe stattfinden etwa in einer Schule, in einem Skatepark, einem Café, einem Begegnungszentrum, einem Einkaufszentrum, einer Sprachschule etc. Dort kann das Ensemble sich mit seiner Aktion (etwa einem Workshop, einem Flashmob, einem Ständchen oder einem musikalischen Spaziergang) präsentieren, mit den Menschen vor Ort in Interaktion treten und sie auch persönlich ansprechen und Fragen beantworten.
Auch für ein neues Ensemble kann eine derartige Aktion stattfinden. Sie sollte im Stil des neuen Ensembles bzw. der neuen Zielgruppe durchgeführt werden und sie dadurch ansprechen: etwa ein interaktives Kinderkonzert mit der Möglichkeit Instrumente auszuprobieren für das Nachwuchsensemble des Blasmusikvereins oder ein Songschreibe-Workshop für den Jugend-Popchor.
Auch kann ein Projektensemble interessierte, aber noch unentschlossene Menschen dauerhaft begeistern und binden. Am Projektensemble kann das bestehende Ensemble geschlossen teilnehmen, wodurch die Projektteilnehmenden in die Gemeinschaft und das Ensembleerlebnis miteingeschlossen werden. Die Ungebundenheit senkt die Hemmschwelle für eine Teilnahme und auch Freunde können so einfacher mitgebracht werden. Durch diese Erfahrung können Personen motiviert werden, auch langfristig Teil eines Ensembles zu werden – und sie kennen dann bereits eine Gruppe von Menschen, der sie sich anschließen können.
Ebenso eignen sich Kooperationen mit anderen musikalischen wie nichtmusikalischen Vereinen bzw. Ensembles. Hier profitieren alle von der Reichweite der anderen Beteiligten und die Projekte können anspruchsvoller und aufwendiger sein, wodurch sie eine größere Ausstrahlung haben. Auch Kooperationen mit Institutionen wie Musikschulen, Schulen oder Jugendorganisationen lohnen sich, da die Personen dort mögliche Interessierte kennen und sie gezielt und persönlich ansprechen können.
Das Interesse neuer Mitglieder kann häufig auch durch eine Erneuerung der Ensemblestrukturen und der Ausrichtung geweckt werden. Gestalten sie regelmäßig Konzerte, Aufführungen oder Aktionen, die z.B. von Kreativität oder starkem Gemeinschaftsgeist geprägt sind, können Sie eher Menschen dazu motivieren, ein Teil des Ensembles sein zu wollen. Sollten Sie als Ensemble dazu bereit sein, können Sie über eine Neuausrichtung ihrer Identität und ihrer Ziele nachdenken. Wieso nicht auch andere Genres ausprobieren, wenn dadurch Jugendliche mitsingen? Vielleicht könnten wir uns auch interkulturell engagieren und mit Geflüchteten oder Migrant*innen Lieder aus aller Welt singen? Wie wäre es damit, ein Familienorchester zu werden? An Alltagsorten aufzutreten? Zusammen mit Ensembles aufzutreten, die ganz anders sind?
Auch ist es wichtig, die Vereins- und Organisationsstrukturen zu hinterfragen: Ist dort wirklich Raum für die Bedürfnisse und Wünsche anderer Generationen oder neuer Mitglieder? Können neue Mitglieder sich einbringen und mitgestalten? Nutzen wir die modernen Möglichkeiten der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit? Was müsste sich verändern, dass Veränderung möglich wird?
Impulsfragen
- Welche Zielgruppe möchten wir wofür ansprechen?
- Was sind Interessen, Bedürfnisse, Wünsche, Orte und Umgangsformen der Zielgruppe?
- Wie könnten wir ein Nachwuchsensemble gründen?
- Welche Werbeaktionen für ein neues oder bestehendes Ensemble könnten wir durchführen?
- Gibt es die Möglichkeit eines Projektensembles?
- Mit welchen Ensembles, Vereinen oder Institutionen könnten wir für Auftritte aber auch Ansprache von Nachwuchs kooperieren?
- Kann eine Erneuerung unserer Ensemblestruktur helfen?
Selbstverständnis und Image
Ein klares Selbstverständnis und ein positives Image stärken die Bindung zum Ensemble und laden neue Mitglieder ein. Wie können beide entwickelt werden? Welche Aspekte sollten dabei bedacht werden? Wie kann ein Image verändert werden?
Um ein positives Image zu erzeugen und die Mitgliederbindung zu stärken, sollte im Ensemble ein Selbstverständnis entwickelt oder präzisiert werden. Wer sind wir? Wofür stehen wir menschlich und musikalisch? Was sind unsere Ziele? Sind diese Fragen geklärt, können sich bestehende und potentielle Mitglieder besser mit dem Ensemble identifizieren. Auch die Mundpropaganda über das Ensemble wird so angeregt, da die Mitglieder klarer vor Augen haben, wie sie über das Ensemble sprechen können. Darüber hinaus kann nun auch die Öffentlichkeitsarbeit zielgerichteter erfolgen.
Das Selbstverständnis und möglicherweise Alleinstellungsmerkmal eines Ensembles sollte gemeinsam mit den Mitgliedern entwickelt oder präzisiert werden. Das kann in einem längeren Workshop erfolgen oder auch schrittweise: Zunächst werden Aspekte des Selbstverständnisses gesammelt, etwa in der Probenpause mit Zetteln, an einer Tafel oder auch außerhalb der Probe per digitalem Fragebogen oder auf einer Online-Plattform z.B. Padlet. Bei Kinder- und Jugendensembles können auch die Eltern mit ihren Wünschen einbezogen werden. Später werden die Aspekte zusammengetragen und diskutiert: Haben wir dieselben Ansichten, Wünsche, Ziele? Ist unsere Identität vielleicht die Unterschiedlichkeit unserer Gruppe? Wie kann das Selbstverständnis aktuelle Mitglieder einschließen und neue ansprechen?
Vor allem bei einer Neugründung, aber auch bei einer Neuausrichtung sollte zusätzlich geklärt werden, welche Angebote und Ensembles es in der Umgebung als direkte Konkurrenz gibt. Wie kann das Selbstverständnis diese Konkurrenz vermeiden? Welche Nischen können möglicherweise gefunden werden?
Ist die Ensemble- oder Vereinsidentität klar, kann man nun gemeinsam ein Image entwickeln: Wie möchten wir in der Öffentlichkeit, von Eltern, potentiellen Mitgliedern wahrgenommen werden? Wie passt dieses gewünscht Bild zu unserem Selbstverständnis? Wie könnten Selbstverständnis und gewünschtes Image verbunden werden z.B. Tradition mit Jugendkultur?
Zusätzlich sollte hinterfragt werden, ob die Organisationsstrukturen und die Kommunikationskultur zum gewünschten Image passen. Können viele Mitglieder sich einbringen? Auf welche Weisen? Kann die Jugend sich einbringen? Wird transparent kommuniziert, den Mitgliedern etwas zugetraut? Was sagen die Mitglieder, die Jugend, die Eltern dazu? Bei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen kann eruiert werden, ob etwas an den Organisationsstrukturen und Kommunikationsweisen geändert werden sollte, um das gewünschte Selbstverständnis und Image zu erhalten.
Anhand des erarbeiteten Selbstverständnisses und Ziel-Images kann das Ensemble bzw. der Verein gemeinsam mit den Mitgliedern einen passenden Namen und Stil für das jeweilige Ensembles finden, die dessen innere und äußere Identität abbilden und auch seinen Wiedererkennungswert erhöhen. Auch eine “Vision” des Ensembles kann hier formuliert werden, die die Ausrichtung, das Ziel oder die Motivation des Ensembles beschreibt. Der Stil und Vision spiegeln sich sowohl in grafischem Design, etwa eines Logos, von Plakaten, der Website oder von Merchandise-Artikeln, aber auch in Auftritten und Angeboten: Den Aufführungsformen, der Konzertkleidung, den Gemeinschafts- und Freizeitaktionen.
Ein Image kann auch aufgebaut, verändert oder modernisiert werden, indem neue künstlerische Wege öffentlichkeitswirksam erkundet werden. Etwa neue Auftrittsformen im öffentlichen Raum oder interaktive Auftritte. Zusätzlich kann eine Erweiterung des Repertoires um neue Genres oder Genre-Mischungen sowie ein stärkeres Nutzen von digitalen Medien (Musikvideos, Kurzvideos mit Einblicken oder Aktionen für die Sozialen Medien, Konzertstreams, Fotogalerien, Interviews etc.) zielführend sein.
Auch neue Zielgruppen verändern das Image: Kinderkonzerte, Aufführungen an Orten der Jugendkultur mit Jugendlichen, mit Menschen verschiedener Kulturen, Religionen, Altersgruppen, Bedürfnisse – sowohl im Publikum als auch im Ensemble.
Soziales Engagement und Kooperationen schaffen ebenfalls ein positives und deutliches Image: Konzerte in Pflegeheimen, Benefizkonzerte, Gratisunterricht für Bedürftige, Singpausen in Schulen, Gutscheine für Schüler*innen, kreative Spendensysteme, spezielle Angebote für sozial Benachteiligte oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen, musikalische Aktionen zu gesellschaftlich relevanten Themen u.v.m. Hier kann mit Schulen und speziellen Einrichtungen kooperiert werden, aber auch mit anderen Ensembles, Kulturvereinen, Theatern und Gemeinden/Städten.
Bei allen neuen Wegen ist nicht nur die mediale Selbstdarstellung (z.B. auf einer Website, in den Sozialen Medien) wichtig, sondern auch die Pressearbeit. Melden Sie sich bei der lokalen Zeitung oder einer Online-Redaktion und fragen Sie nach der passenden Kontaktperson und der passenden Art und Weise (Kontaktweg sowie Inhalte), wie diese Person über besondere Auftritte oder Aktionen mit Nachrichtenwert informiert werden möchte. Typischerweise ist es hilfreich, für eine Aufführungsankündigung oder als Nachbericht einen druckreifen Absatz auszuformulieren und ein Ensemblefoto in hoher Auflösung mit Angabe des*der Fotograf*in mitzuschicken. Laden Sie Ihren Pressekontakt außerdem zu Veranstaltungen oder Aktionen ein und betreuen Sie die Person vor Ort mit einem Platz, einer Ansprechperson, indem Sie ein Foto koordinieren etc. So erhöhen Sie die Chance, öffentlich in der Form präsent zu werden, die Ihrem Image zuträglich ist.
Impulsfragen
- Wie sehen wir uns? Was macht uns aus?
- Wie möchten wir werden? Wie möchten wir gesehen werden?
- Was für Kommunikations- und Musikformen bräuchte es dazu?
- Welche Angebote und Möglichkeiten sich einzubringen bräuchte es dazu?
- Wie könnten wir uns von konkurrierenden Ensembles/Angeboten abgrenzen?
- Welche neuen künstlerischen und sozialen Wege schaffen und verändern ein Image?
- Welche Kanäle und Kontakte müssten wir pflegen, um öffentlich wahrgenommen zu werden?
Neustrukturierung des Ensembleauftritts
Die öffentliche Präsenz eines Ensembles ist elementar für die Ansprache neuer Mitglieder und Zielgruppen. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Wie können sie gestaltet werden und wen erreichen sie?
Um neue Mitglieder und Zielgruppen anzusprechen und gleichzeitig das Selbstverständnis und die Identität des Ensembles besser nach außen zu kommunizieren, empfiehlt es sich, den öffentlichen Auftritt des Ensembles stetig anzupassen und anzugleichen.
Neben dem Social-Media-Auftritt bietet eine Website eine unkomplizierte Möglichkeit, sich über ein Ensemble zu informieren. Dementsprechend sollte diese auf den ersten Blick viele Informationen bieten, ansprechend gestaltet und einfach zu bedienen sein. Wählen Sie einfache Sprache, kurze Texte und ansprechende Bilder. Setzen Sie Ihr Logo in Szene. Bei allen Überlegungen sollte im Vordergrund stehen, wie die Identität Ihres Ensembles am besten abgebildet werden kann.
Es gibt Möglichkeiten, mit einfachen Mitteln eine Basis-Websiteselbstständig zu gestalten (z.B. mit WordPress) oder ein fertiges Baukastensystem von Website-Anbietern gegen etwas Miete zu nutzen (z.B. jimdo, wix, musikerseiten.de…). Vielleicht finden Sie technik-begeisterte Mitglieder, die sich dieser Aufgabe annehmen und sich so gleichzeitig für das Ensemble engagieren können. Zu Bedenken ist hierbei, dass eine Website ständig gepflegt werden muss (Aktuelles, neue Bilder, Konzertankündigungen, …).
Auf einer Website können Sie auch (passwortgeschützt oder in einem internen Bereich) Materialien zur Verfügung stellen wie etwa Probenpläne, Noten, Informationen oder Formulare und Anmeldungen verwalten.
Über das Logo erhalten Außenstehende einen ersten Eindruck vom Ensemble. Es kann also sinnvoll sein, das Logo stetig anzupassen – insbesondere dann, wenn sich ein Ensemble neu strukturiert oder stark verändert. Bei der Überarbeitung eines Logos können Mitglieder tätig werden, welche an einem zeitlich begrenzten Projekt beteiligt sein wollen und gegebenenfalls nicht die Möglichkeit haben, sich kontinuierlich im Ensemble zu engagieren. Überlegungen zur Gestaltung sollten aus dem Ensemble kommen. Es empfiehlt sich, die Ausarbeitung der Ideen aus dem Ensemble von einem Profi durchführen zu lassen.
Social-Media-Plattformen bieten die Möglichkeit neue, junge Zielgruppen anzusprechen, mit anderen Ensembles und Gruppierungen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Außerdem können Online-Events veranstaltet werden. Es bietet sich an, zur Gestaltung des Social-Media-Auftritts junge Mitglieder einzubeziehen und ihnen so Verantwortung zu übertragen. Die Pflege der Social-Media-Kanäle muss jedoch kontinuierlich erfolgen und kann sehr zeitaufwendig werden.
Instagram spricht vor allem junge Menschen an. Die Kommunikation erfolgt über Bilder und Videos, welche jedoch beschrieben und kommentiert werden können. Besonders diese Plattform bietet die Möglichkeit, kreativ zu sein. Organisieren Sie beispielsweise eine Challenge (Balkon-Musik, Übe-Challenges, Bild mit dem Instrument posten, …), an der Musikbegeisterte teilnehmen können. Stärken Sie so den Zusammenhalt in Ihrem Ensemble und erwecken Sie Aufmerksamkeit. Teilen Sie Split-Screen-Videos oder Ausschnitte aus Konzert-Aufnahmen.
Ähnliche Möglichkeiten bietet die Plattform Facebook. Sie ist jedoch besser geeignet, um längere, informationsreiche Texte einzubeziehen. Hier können darüber hinaus sogenannte Watch Partys stattfinden, in der Sie mit Ihren Mitgliedern gemeinsam Videos anschauen und sich währenddessen unterhalten können. Facebook bietet außerdem eine unkomplizierte Möglichkeit, Live-Streams zu übertragen, sodass Sie virtuelle Konzerte veranstalten können.
Impulsfragen
- Was möchte das Ensemble nach außen vermitteln?
- Wie und wo möchte es auftreten?
- Was sind Schwerpunkte und Zielgruppen der Arbeit des Ensembles und wie können diese dargestellt werden?
- Wie seriös soll der Internet-Auftritt sein? Welche Aktivitäten rund um das Musizieren, aber auch darüber hinaus, sollen dort gezeigt werden?
- Was soll mit dem Logo ausgedrückt werden? Soll es etwas Konkretes darstellen?
- Ist ein traditionelles Design eines Logos noch zeitgemäß? Muss es überarbeitet oder komplett neu sein? Kann das traditionelle Logo mit neuen Ideen ergänzt werden?
- Wie kann ein Bild oder ein kurzes Video auf Instagram oder Facebook die Arbeit im Ensemble besonders gut darstellen? Wie können andere Ensembles oder Mitglieder mit einbezogen werden, sodass Beiträge geteilt und so verbreitet werden? Wie oft sollen neue Beiträge gepostet werden?
Neustrukturierung der Ensembleorganisation
Möchte sich ein Ensemble weiterentwickeln, ist oft eine Veränderung der Organisationsstruktur sinnvoll. Wie kann die eigene Struktur hinterfragt und verbessert werden? Wie können junge Leute und normale Mitglieder einbezogen werden?
Möchte sich ein Ensemble weiterentwickeln, ist eine Veränderung innerhalb der Organisationsstrukturen sinnvoll. Dies kann sowohl die Optimierung von Arbeitsabläufen und Kommunikation betreffen, als auch die Beteiligung von Ensemblemitgliedern, welche sich bisher noch nicht oder nur wenig engagieren.
Organisationstrukturen und Kommunikation
Bestehende Organisationsstrukturen sollten regelmäßig dahingehend überprüft werden, ob sie noch zu den Bedürfnissen des Ensembles passen. Die eigene Struktur sollte klar definierte Zuständigkeiten, Kommunikationswege und Dokumentationen beinhalten. Auch die eigene Ausrichtung sollte hinterfragt werden: Haben wir eine klare Identität und Ziele, engagieren wir uns entsprechend? Sind unsere Abläufe und Sitzungen inhaltsorientiert und effektiv? Welche Fortbildung oder professionelle Unterstützung benötigen wir? Fühlen sich alle wertgeschätzt?
Verändern sich die Bedürfnisse eines Ensembles, müssen neue Aufgabenbereiche geschaffen und Aufgaben neu verteilt werden. Möchte ein Ensemble neue Mitglieder gewinnen, könnte es nötig sein, eine Person exklusiv mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Möchte ein Ensemble seine Kommunikation nach außen verbessern (Gendern, Political Correctness, Ansprache von Zielgruppen, …) erfordert dies gegebenenfalls andere Strategien als bisher und andere Personen können die Chance erhalten, sich mit ihren Stärken und ihrem Wissen einzubringen. Es lohnt sich außerdem, einen Blick auf das Ensemble zu werfen: Wo ist vielleicht ungenutztes Potential zu finden?
Um Nachwuchs im Ehrenamt besonders durch Jugendliche und junge Menschen zu fördern, muss der Raum zum Ausprobieren geschaffen werden. Hier kann es hilfreich sein, kürzere Amtszeiten zu definieren, Hilfe bei der Einarbeitung anzubieten, Verantwortlichkeiten für einzelne Projekte oder kleine Aufgabenbereiche zu vergeben oder Arbeitskreise zu bilden. Auch ein Jugendvorstand mit eigenem Budget sowie Weiterbildungsmöglichkeiten sind weiterer Ansporn für junge Leute, sich in der Vereinsarbeit zu engagieren.
Um jüngere Mitglieder einzubinden und Abläufe zu optimieren, können Kommunikations- und Organisationstools wie Agantty oder Slack genutzt werden. Diese ermöglichen es, feste Aufgaben zu verteilen, To-do-Listen anzulegen und transparent miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten. Ensemblemitglieder, welche nicht direkt an der Organisation des Ensembles beteiligt sind, können so Einblicke in die Arbeit von Vorständen, Projektteams, Leiter*innen und Verantwortliche nehmen und gegebenenfalls neue Impulse einbringen und selbst Interesse an Engagement entwickeln.
Partizipation und Identität
Wenn Ensembles an alten Konzepten festhalten und diese nicht überdenken, nimmt man vielen Mitgliedern die Möglichkeit, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. Bestehende Hierarchien oder festgefahrene Strukturen können verhindern, dass sich insbesondere Jüngere engagieren und einbringen. In Mitgliederversammlungen oder -befragungen kann zunächst ein Stimmungsbild zu verschiedenen Themen eingeholt werden. Diese sind mit geringem Aufwand online oder hybrid (z. B. mit Zoom) durchführbar, sodass der Zugang für alle Mitglieder möglich gemacht werden kann. So kann bereits ohne feste Positionen oder Aufgaben zu übernehmen, jedes Mitglied an der Gestaltung des Ensembles mitwirken.
Um tiefer über Partizipation und Identität nachzudenken, kann ein Ensemble von der Durchführung einer sogenannten Zukunftswerkstatt profitieren. Angeleitet durch eine*n (externe*n) Coach können alle Ensemblemitglieder gleichberechtigt an einem vorab festgelegten Thema arbeiten. Dies könnte beispielsweise die Planung konkreter Projekte, die Neuausrichtung eines Ensembles, Behandlung von Problemen, Visionen oder ein Neustart nach einer Pause sein. Diese Methode bietet die Möglichkeit, nicht nur Entscheidungsträger und Verantwortliche zu Wort kommen zu lassen, sondern die Bedürfnisse aller einzubeziehen und so völlig neue Lösungswege zu finden.
Impulsfragen
- Wie kann die Kommunikation zwischen Ensemblemitgliedern erleichtert werden, sodass sich alle Mitglieder einbringen können? Können digitale die Strukturen bereichern?
- Passen und Organisations- und Kommunikationsstrukturen noch zu unserem Ensemble?
- Was sind Stärken und Kompetenzen unserer Mitglieder? Könnten diese das Ensemble bereichern?
- Wie können Strukturen so geschaffen werden, dass sich alle Ensemblemitglieder vertreten fühlen?
- Wer möchte sich gegebenenfalls engagieren, aber hatte bisher noch nicht die Möglichkeit dazu?
- Wie können alle Mitglieder zu Wort kommen; auch ohne feste Positionen im Organisationsteam?
- Welche Aufgabenbereiche müssen geschaffen bzw. angepasst werden?
- Wer könnte innovative, neue Ideen einbringen?
- Welche Themen beschäftigen das Ensemble? Was sind Stärken und Schwächen, Probleme und Bedürfnisse?
Neustrukturierung von Materialien
Eine Bestandsaufnahme und Neusortierung von Instrumenten und Noten schafft Platz und Überblick. Welche Möglichkeiten gibt es hier?
Wenn Probenarbeit nur eingeschränkt möglich ist oder wenige Konzerte oder Auftritte anstehen, kann die Zeit genutzt werden eine Bestandsaufnahme von Materialien (Noten, Instrumente, etc.) und diese neu- und auszusortieren. Gemeinsame Aufräumaktionen und dadurch wieder Platz und Ordnung zu schaffen, können Ensemblemitglieder miteinander verbinden und einen Neustart nach längeren Pausen, Neuorientierung eines Ensembles oder Wechsel von Verantwortlichen einleiten.
In diesem Zuge kann außerdem über die Digitalisierung von Noten nachgedacht und alte Instrumente wieder instandgesetzt werden. Die Katalogisierung von Noten ermöglicht außerdem das schnelle Finden von Notensätzen und hilft den Überblick zu bewahren.
Regelmäßig einen Blick auf die Finanzen zu haben und dies regelmäßig transparent allen Ensemblemitgliedern darzustellen, ist natürlich besonders bei der Neuanschaffung von Materialien wichtig.
Impulsfragen
- Gibt es Potential (Probe-)Räume besser zu nutzen?
- Können Notensätze in meinem Ensemble schnell gefunden werden oder müssen diese katalogisiert werden?
- Sollten unsere Noten/Notenkataloge digitalisiert werden?
- Passt das vorhandene Notenmaterial noch zu meinem Ensemble?
- Welche Materialien werden wirklich noch gebraucht? Kann damit noch Geld verdient werden?
- Würde mein Ensemble von einer gemeinsamen Aufräumaktion gestärkt werden?
- Könnte eine gemeinsame Aufräumaktion einen Neuanfang für mein Ensemble darstellen?
- Wissen alle Mitglieder wie es um die Finanzen steht?
- Kann es sich mein Ensemble leisten, Noten oder Instrumente auszusortieren oder muss gegebenenfalls noch einmal darauf zurückgegriffen werden?
Chancen durch Coaching
Wie kann ein Coaching bei der Ensembleentwicklung helfen?
Immer wieder berichten Vereine darüber, dass es schwierig sei, Nachwuchs für die Gremienarbeit zu finden oder dass das Orchester aufgrund fehlenden Nachwuchses schrumpfe. Darüber hinaus gibt es viele Aufgaben, mit denen sich Vereine konfrontiert sehen, aber nicht wissen, wie sie diese angehen sollen. Die gute Nachricht ist: Diese Themen muss man nicht alleine bewältigen. Es gibt in der Amateurmusik- und Vereinswelt viele Menschen, die sich intensiv mit der Lösung dieser Probleme beschäftigen und Vereine begleiten. In sogenannten Coachings werden Entwicklungsprozesse verfolgt, die bei der Erfassung des Ist-Zustands und des Soll-Zustands (Wunsch-Zustand und Ziele) ansetzen, um schließlich gemeinsam mit den Beteiligten in den Ensembles und Vereinen Strategien auszuarbeiten, um diese Ziele zu erreichen. Hier werden bspw. mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung u.a. die Vereins- und Gremienstrukturen modernisiert, die Außendarstellung professionalisiert oder über die programmatische Gestaltung gesprochen.
Sollten Sie an einem solchen Coaching interessiert sein, kann Ihnen Ihr Verband sicherlich entsprechende Coaches empfehlen. Schauen Sie dazu gerne auch bei dem Beitrag „Weiterentwicklung von Ensembles und Vereinen“ unter Themen und Dozent*innen zur Weiterbildung.
Beispielhafte Fragestellungen, die Anlass für ein Coaching geben können:
- Wie finden wir Nachwuchs?
- Wie schaffen wir den Generationenübergang?
- Wie können wir intern gut/besser kommunizieren und alle mitnehmen?
- Wie stellen wir uns für die Zukunft auf?
- Wie gewinnen wir neues Publikum und Nachwuchs? Wie heben wir uns von anderen Freizeitangeboten ab?
- Wie können wir unser musikalisches Niveau anheben?
- Wie entdecken wir musikalisch neue Wege und Möglichkeiten der Profilierung?
Tipp: Publikation „Zukunft.Musik.Gestalten“
Nutzen Sie die Publikation Impulse und Leitfäden zur Weiterentwicklung von Ensembles und Vereinen. Sie unterstützen Vereine und Ensembles dabei, wichtige und notwendige Veränderungen anzugehen, neue Strukturen zu etablieren und den eigenen Verein bzw. das eigene Ensemble weiterzuentwickeln. Dabei ist die Publikation so aufgebaut, dass die Themen anhand der Reflexionsleitfäden und passender Methoden selbst erarbeitet werden können und durch anschauliche Praxisbeispiele ergänzt werden. Sie gibt Hilfestellung zu Mitgliedergewinnung, Image und Öffentlichkeitsarbeit und richtet sich an Musiker*innen, Vorstände, Ensembles und Vereine aller Sparten und Genres.