Nicht nur Wirtschaftsunternehmen verfolgen Ansätze der Effizienz und Beschleunigung, diese können und sollten auch auf die Tätigkeiten eines eingetragenen Vereins – auch wenn (oder gerade weil) dieser gemeinnützige Ziele verfolgt – übertragen werden.
Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Sie haben soeben erfolgreich einen eingetragenen Verein gegründet, eine stimmige Satzung, die die Grundlagen des Vereins regelt beschlossen und wollen nun stringent ihr satzungsgemäßes Vereinsziel umsetzen.
Aber wer macht eigentlich was? Wie sind die einzelnen Vereinstätigkeiten konkret durchzuführen? Wie soll die Mitgliederversammlung ablaufen? Erfolgen Beschlüsse der Mitgliederversammlung durch Handzeichen, oder Wahlzettel? Wie soll eine Vorstandssitzung erfolgen?
Schon kann es zu den ersten Diskussionen zwischen den Mitgliedern und Verzögerungen in der Vereinsarbeit kommen. Dabei hatten Sie doch extra eine schlüssige Satzung erarbeitet! Hier hilft die Geschäftsordnung.
Inhalt
Download: Muster-Geschäftsordnung
Im Folgenden wird eine Geschäftsordnung zur Regelung der Versammlung eines Vereinsorgans dargestellt, die als Muster dienen kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass regelmäßig eine individuelle Geschäftsordnung zu erstellen ist, die die jeweiligen Umstände und konkreten Regelungsbedürfnisse aufgreift und abbildet.[4] Die untenstehende Geschäftsordnung regelt den konkreten Ablauf einer Vereinsversammlung.
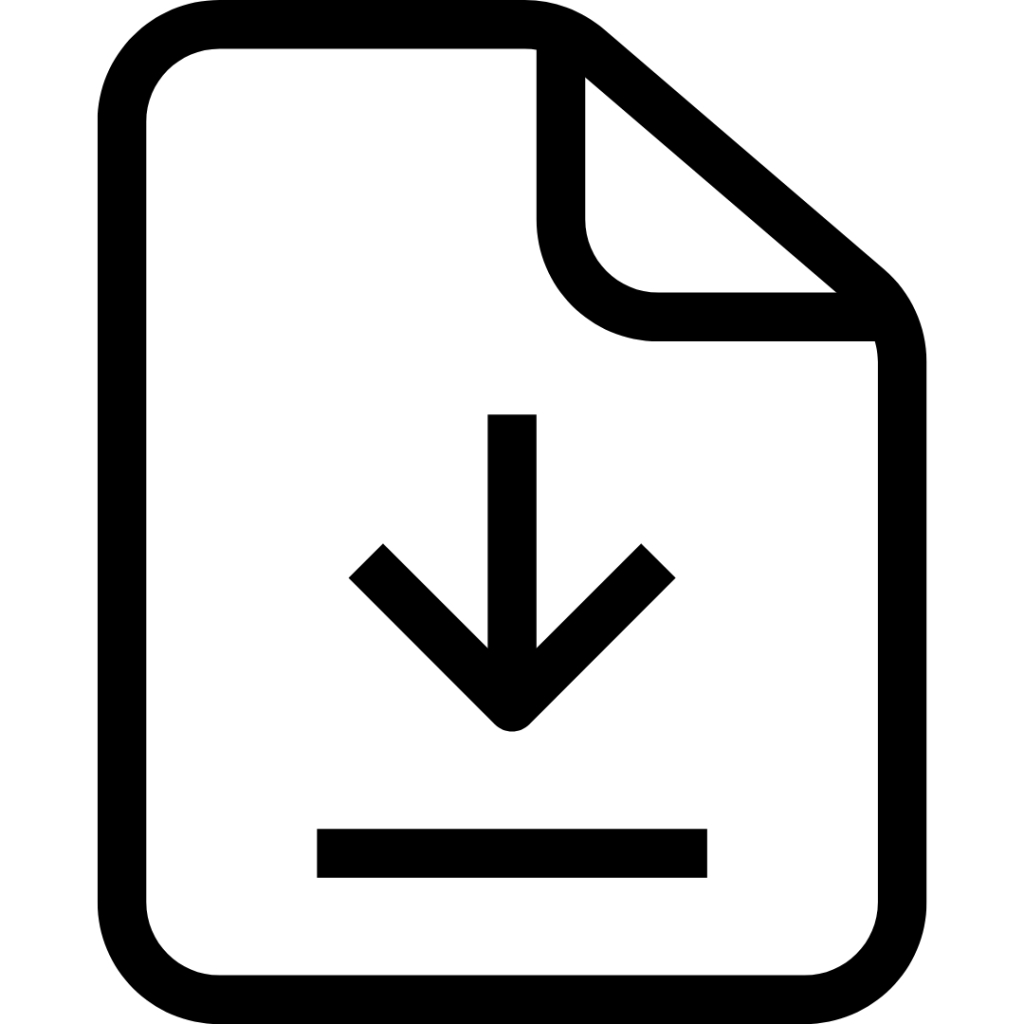
Passende Downloads
Weitere Artikel aus der Reihe
Was kann eine Geschäftsordnung regeln?
Unumstößlich regelt allein die Satzung die signifikanten Grundlagen ihres Vereins, wie es auch gesetzlich in § 57 BGB vorgesehen ist. Jedoch wird eben durch eine allgemein ausgestaltete Satzung noch nicht konkret geklärt, wie die Abläufe des Vereins in der Praxis erfolgen sollen. Genau um auf diese etwaigen Unklarheiten rechtssicher und transparent zu reagieren, kann sich das jeweilige Vereinsorgan auch ohne eine gesonderte Ermächtigung eine Geschäftsordnung geben.[1] Bei der Geschäftsordnung handelt es sich demnach um eine verbindliche und verschriftlichte Regelung der Abläufe und Prozesse innerhalb eines Vereinsorgans, wie der Mitgliederversammlung oder dem Vereinsvorstand. Grenzen der Regelungsfreiheit ergeben sich lediglich durch die Satzung selbst, oder durch die unverfügbaren Mitgliedschaftsrechte. Eine Geschäftsordnung regelt damit allein die interne Organisation und das Verfahren (den Geschäftsgang) eines Vereinsorgans.[2]
Beispielsfragen für Regelungsbereiche in einer Geschäftsordnung sind:
- Auf welcher Grundlage werden die Teilnehmer zu einer Sitzung eingeladen? Wie erhalten die Teilnehmer Kenntnis vom Termin?
- Wer leitet die Sitzung? Welche Rechte und Pflichten hat ein Versammlungsleiter?
- Wie geht der Verein mit schriftlichen Anträgen um? Wer kann einen Antrag stellen? – Welche Formalitäten gelten für Anträge? Wann sind Dringlichkeitsanträge möglich?
- In welcher Form wird über Anträge abgestimmt? Welcher Personenkreis ist stimmberechtigt? Erfolgen Abstimmungen offen oder geheim? Welche Mehrheit entscheidet?
- Wer ist für das Anfertigen von Protokollen zuständig? Wie werden die Vereinsmitglieder über neue Protokolle in Kenntnis gesetzt?
Wie wird eine Geschäftsordnung erlassen?
Der Erlass einer Geschäftsordnung setzt grundsätzlich einen Beschluss des jeweiligen Vereinsorgans mit einfacher Stimmenmehrheit voraus. Der Mitgliederversammlung steht als oberstem Vereinsorgan das Recht zu, für andere Vereinsorgane (z.B. den Vorstand) Geschäftsordnungen zu erlassen. Macht sie von diesem Recht Gebrauch, kann das betreffende Organ nicht mehr selbst eine Geschäftsordnung verabschieden.[3] Anderes gilt nur, wenn die Befugnis zum Erlass einer Geschäftsordnung in der Satzung ausdrücklich dem betreffenden (oder einem anderen, dritten) Organ zugewiesen wird. Dann darf sich die Mitgliederversammlung über diese Zuweisung nicht hinwegsetzen, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt.
Vor- und Nachteile einer Geschäftsordnung
Nach unserem Dafürhalten überwiegen regelmäßig die Vorteile einer Geschäftsordnung. Durch die Geschäftsordnung kann der Verein schneller und effektiver agieren. Die internen Prozesse werden systematisiert und professionalisiert. Etwaige Nachfragen und Unsicherheiten beim Ablauf und der Zuständigkeitsverteilung können minimiert werden. Sofern diese Abläufe und Inhalte der Geschäftsordnung wieder geändert werden sollen, kann dies schnell und ohne – wie bei einer Satzungsänderung – eine regelmäßig erforderliche Dreiviertelmehrheit der Mitgliederversammlung erfolgen.
Demgegenüber erfordert der Entwurf einer Geschäftsordnung gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts, respektive einen gewissen vereinsinternen Aufwand. Dies ist insbesondere notwendig, um die Inhalte der Geschäftsordnung kompatibel mit den Satzungsinhalten abzustimmen.
Gerade größeren Vereinen mit komplexeren Strukturen wird die Verabschiedung einer Geschäftsordnung empfohlen.

Jonas David Jacob
Allgemeiner Cäcilienverband Deutschland e.V.
Erstellt: November 2022
Zuletzt bearbeitet: Juni 2023
Fußnoten
[1] BGH, Urteil vom 6. 3. 1967 – II ZR 231/64 (München)
[2] BeckOGK/Segna, 1.8.2022, BGB § 25 Rn. 41
[3] Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 5, § 19 Rn.9
[4] Die Geschäftsordnung muss – wie dargestellt – stets mit der Satzung kompatibel sein. Im Zweifelsfall geht immer die Satzungsregelung vor.