Inhalt
Musiktheater entwickeln
Ein Musiktheater kann gemeinsam mit den Teilnehmenden in Form, Thema, Musizier- und Auftrittsarten entwickelt werden. Wie läuft das ab? Welche Ausgangspunkte und Stückformen sind möglich?
Ein Musiktheater ist für viele Ensembles eine besondere und intensive Erfahrung. Bei einer partizipativen Stückentwicklung entwickeln Teilnehmende zusammen mit einer Spielleitung ein Stück. Dabei werden inhaltliche, materielle oder formale Impulse aufgenommen und Fragestellungen sowie eine Form für das Stück entwickelt. Ausgangsmaterial und Form (etwa eine Geschichte oder eine Szenencollage) können entweder schon vorher feststehen oder auch im Prozess entwickelt werden. Die Teilnehmenden bestimmen inhaltlich und künstlerisch mit und werden im Laufe der Entwicklung immer selbstständiger. Fragestellungen knüpfen an die Lebenswelt und persönliche Erfahrungen der Teilnehmenden an, sowohl bei der Beschäftigung mit festem Material als auch bei einer völlig freien Entwicklung.
Als Spielleitung ist es wichtig, die Teilnehmenden weder zu bevormunden, noch sie zu überfordern und am Ende in einer Form auf die Bühne zu schicken, die sie selbst als ausreichend empfinden. Bei biografischem Arbeiten ist es außerdem wichtig, immer künstlerisch zu verfremden. Die Spielleitung unterstützt das Entstehen eines individuellen künstlerischen Ausdrucks und schafft Raum für ein Ausprobieren und Zusammenwachsen der Gruppe. Hier können vor allem theaterpädagogische Gruppenübungen hilfreich sein.
Meist wird hier eine freie Stückform gewählt, in der Szenen zu einer Collage oder themengebunden zu einer Montage verbunden werden. Die Stückentwicklung beginnt mit einer Sammlung: Welche Fragen interessieren uns? Welche Arten der Performance interessieren uns? Möchten wir lieber mit Medien arbeiten, mit Bewegungen, Lichteffekten, Objekten etc.? Anschließend folgt eine Materialsammlung (Lieder, Instrumente, Gedichte, Gegenstände, andere Genres…) und mit diesem Material wird improvisiert, experimentiert und verschiedenen Umsetzungsformen erprobt. Welche Rolle kann die Musik spielen? Nun wird es konkreter: Das Entwickelte wird ausgewählt und geordnet, ein möglicher roter Faden gesucht und eine Spannungsabfolge ausprobiert. Im Anschluss daran werden Szenen und Abläufe weiterentwickelt und geprobt, so dass sie zu einem Gesamtwerk zusammenwachsen.
Auch Bühnenbild, Requisiten, Kostüme oder Maske können von den Teilnehmenden selbst gestaltet werden. So können sie in einer Werkstatt unter Anleitung etwa eigene Kulissen anfertigen und bemalen, Umhänge nähen, Hüte basteln u.v.m.
Impulsfragen
- Wollen wir völlig frei oder mit Basismaterial ein Stück entwickeln?
- Wie kann ich als Spielleitung Raum für Ausprobieren und Gruppenzusammenhalt schaffen?
- Welche Themen interessieren uns? Soll es ein Hauptthema geben?
- Welche Arten von Performance und Umsetzung interessieren uns?
- Welches Material fällt uns dazu ein, könnten wir integrieren?
- Wie könnten wir das Material umsetzen? Wie noch?
- Welche Rolle spielt die Musik dabei?
- Was möchten wir auf die Bühne bringen und in welcher Form und Folge?
- Was könnte der rote Faden und die Gesamtaussage sein?
- Wie könnten Bühnenbild und Kostüm selbst gestaltet und hergestellt werden?
Musiktheater inszenieren
Wie erarbeitet man eine Inszenierung konzeptionell? Welche Mittel kann man dafür nutzen? Welche Personen sind beteiligt?
Gerade mit Chören, aber auch mit anderen Ensembles kann es interessant sein, ein Musiktheater aufzuführen. Vom Händel-Oratorium über Musicals bis zum Abschluss eines Ferienkurses ist hier alles möglich. Soll das Stück mit wenig Aufwand in Szene gesetzt werden, müssen verschiedene Aspekte der Inszenierung beachtet und diese an das Projekt angepasst werden.
Wird mit einem bestehenden Stück gearbeitet, sollte es auf bestimmte Aspekte hin analysiert werden: Themen, Perspektiven, Figuren, Handlungsabläufe, Aufbau, Spannungsverlauf, Orte, Zeit etc. Wo sind Schlüsselmomente? Wo ist Komik, wo Illusionsbruch? Auch entwickelte Szenencollagen haben Themen, Spannungsverläufe, einen roten Faden und besondere Momente.
Das gesamte Setting des Stücks orientiert sich an Themen, Figurenschicksalen sowie dem Aufführungsort. Soll die Geschichte vielleicht in die heutige Zeit gebracht werden? Welche Lokalitäten können anders interpretiert werden? Ist der See vielleicht ein Schwimmbad? Sind der König und das Volk vielleicht ein Lehrer und seine Schüler*innen? Welche Lebenswelt interessiert uns, ist uns nahe?
Die Ausstattung schließt Maske, Kostüm, Requisiten und Bühnenbild ein. Für Kostüm und Requisiten kann ein Versetzen des Stücks in die heutige Zeit helfen, um passendes privates Material zu finden. Hilfreich sind auch minimalistische Formen wie eine Kostümbasis (etwa schwarze Kleidung) mit einem Erkennungsaccessoire (Kleidungsstück, Kopfbedeckung, minimalistisch Schminke…). Soll die Kostümbasis uniform sein oder sich an Farbtönen oder modischen Stilen orientieren? Auch eine Wiederverwendung von Requisiten ist hilfreich: Welches Requisit kann in derselben Form für verschiedene Gegenstände stehen? Welches kann dafür einfach verändert oder umgedreht werden? Soll das Stück gemeinsam mit Kindern inszeniert werden, können Kostümideen und Beschreibungen zunächst gesammelt und anschließend auch in Bildern umgesetzt werden, bevor z.B. Eltern mit ihren Kindern die Gestaltung der Kostüme übernehmen.
Ein Bühnenbild kann durch wenig Aufwand sehr vielfältig gestaltet werden. Besonders hilft hier eine Strukturierung durch Wände oder Vorhänge, um Räume und Orte zu definieren und Auftritte von vielen Seiten zu ermöglichen. Die Wände können unterschiedliche Seiten haben und so durch einfache Drehung die Szenerie verwandeln. Genauso können Vorhänge oder Seile einfach umgehängt werden. Möglich sind auch Banner oder Gebilde im Raum (z.B. Statuen, Sitzwürfel, Kisten, Papierfaltungen, Ballons, Lampen…). Auch kann die Szenerie durch Projektionen ersetzt werden und dadurch viele Ortswechsel schnell visualisiert und nur mit wenigen Requisiten umgesetzt werden. Das Bühnenbild kann auch von den Teilnehmenden selbst gestaltet werden: Projektionsmotive werden ausgewählt bzw. fotografiert oder Kulissen in einer Werkstatt gebaut und bemalt.
Eng verknüpft mit dem Bühnenbild ist die Licht- und Videoinzenierung. Die Lichtstimmung gestaltet die Atmosphäre eines Ortes und kann sich beispielsweise mit Emotionen, musikalischen Steigerungen oder neuen Auftritten verändern. Hier sind nicht nur farbliche Abstufungen möglich, sondern auch Effekte wie Blitze oder Nebel. Mit Videoeinspielungen können neben Szenerien vor allem Erinnerungen, Träume und Handlungen an anderen Orten verdeutlicht, Chat-Nachrichten sichtbar gemacht oder dynamische Effekte mit z.B. Formen oder Wörtern gestaltet werden.
Auch der Ton kann mehr als nur verstärken: Wie wäre es mit Einspielungen bei einer Schlägerei, beim Klopfen an die Tür oder dem Schlagen einer Uhr? Der Ton kann auch Stimmungen gut gestalten, etwa eine tiefbrummende Bedrohung, Natur oder Geistergeräusche.
Haben Sie viele Vorgänge, die auch noch präzise an die Musik gebunden sind, kann es sich lohnen, eine Person einzusetzen, die Umbauten, Lichtänderungen, Effekte und Video- oder Toneinspielungen im Probenprozess wie auch live künstlerisch passend koordiniert. An Theatern übernehmen diese Aufgabe Inspizient*innen. Zusätzlich kann diese Person auch die Teilnehmenden hinter der Bühne rechtzeitig zu Auftritten bitten.
Schließlich definiert die Inszenierung auch die Interpretation bestimmter Figuren und die Arbeit mit den Darstellenden an einer schlüssigen Verkörperung. Hier können zunächst gemeinsam Motive, Beziehungen, biografische Hintergründe und Bewegungsformen improvisatorisch erkundet und überlegt werden. Auch die Möglichkeiten des Singens und Sprechens einer Rolle sollten erforscht und diese eventuell passend verfremdet werden.
Impulsfragen
- Welche Themen, Perspektiven, Figuren, Handlungsabläufe gibt es im Stück?
- Wie sind Aufbau, Spannungsverlauf, Orte, Zeit gestaltet?
- Wo sind Schlüsselmomente?
- In welchem Setting könnte das Stück spielen? Welche Orte, Themen, Figuren könnten neu interpretiert werden?
- Welche Accessoires stehen klar für bestimmte Figuren?
- Wie könnten multifunktionale Requisiten aussehen?
- Wie könnte die Bühne strukturiert und einfach umstrukturiert werden?
- Wie können Licht und Video zu Atmosphären, Effekten und Erzählungen beitragen?
- Wie kann der Ton zu Atmosphären, Effekten und Erzählungen beitragen?
- Wie kann gemeinsam mit den Darstellenden ein individueller Stil ihrer Figuren entwickelt werden?
Rollen und Szenen erarbeiten
Wie können Figuren und ihr Körperausdruck erarbeitet werden? Wie können Beziehungen erkundet und verdeutlicht werden? Wie koordiniert man Szenen zur Musik?
Bei der Erarbeitung von Rollen geht es um psychologische und körperliche Aspekte einer Figur. Dafür werden zunächst die Informationen über die Figur aus dem Text und der Musik gesammelt, Hintergründe, Biografisches, Handlungen. Davon werden Motivationen und Beziehungen abgeleitet und Lücken mit eigenen Interpretationen der Figur gefüllt.
Diese Erarbeitung kann über Schlüsselsätze und -momente im Text erfolgen und darüber hinaus mit Interviewfragen angeregt werden. Wie alt bist du? Was kannst du überhaupt nicht leiden? Hier können mehrere Personen als dieselbe Figur antworten oder mehrere Figuren auf die gleiche Frage. Genauso können auch Schlüsselsätze einer Figur von allen nacheinander gesprochen werden – wie unterschiedlich kann der Satz klingen?
Die psychologischen Aspekte definieren nun auch die Körpersprache: Haltungen, Bewegungen, Sprachstil, Stimme etc. Hier kann viel ausprobiert werden: Vorbilder aus dem Alltag imitieren, bestimmte Emotionen und Wirkungen überzeichnen, alltägliche Bewegungsabläufe wie Gehen immer wieder neu gestalten u.v.m. Welche Bewegungen macht die Figur regelmäßig? Raucht sie, hat sie nervöse Zuckungen, körperliche Beschwerden? Ist sie ein Tier? Gibt sie sich besonders cool? Was macht mein Körper im realen Leben, wenn ich diese Emotion habe? Hier können auch bestimmte Requisiten und Kostüme zu Hilfe genommen werden: Wie geht die Figur mit dem Messer um? Wie ändert sich die Haltung mit Mantel und Krone?
Interaktionen sind besonders hilfreich, um die Beziehungen der Figuren zueinander zu erforschen und die Körpersprache in vielen Facetten zu erproben. Um gewissen Beziehungskonstellationen zu verdeutlichen, können hier auch Bilder gestellt werden: Jede*r nimmt eine Rolle ein und visualisiert die Beziehungen zu den anderen klar in einer Körperhaltung.
Dieses Bilderstellen kann auch mit einzelnen Szenen stattfinden. Dort können Beziehungskonstellationen, aber auch Handlungen oder die Essenz der Szene dargestellt werden. Sie können auch anschließend verändert oder ergänzt werden. Um in Szenen die Motivationen der Figuren besser zu verstehen, können diese auch im Subtext gespielt werden: Niemand spricht den richtigen Text, sondern alle das, was ihre Figur damit sagen möchte. Eine Szene zu erkunden ist auch möglich in Nonsens-Sprache, so tritt die nonverbale Kommunikation in den Vordergrund.
Besonders bei monologischen Arien oder Songs hilft es, die Szene nach den musikalischen Impulsen zu gestalten: Aufbau, Affekte und Wechsel werden auch körperlich interpretiert, musikalische Effekte wie Rubati oder Glissandi können durch bestimmte Handlungen oder Bewegungen hervorgehoben werden.
Impulsfragen
- Was sagen der Text und die Musik über die Figur?
- Welche Motivationen und Beziehungen hat die Figur?
- Wie könnten die biografischen und psychologischen Lücken gefüllt werden?
- Welche Körpersprache und welchen Sprechstil hat die Figur?
- Welche Personen aus dem Alltag könnten dafür imitiert oder überzeichnet werden?
- Wie geht die Figur mit Requisiten und Kostümen um?
- Wie interagieren die Figuren? Mit welchen Motiven, Reaktionen und Körpersprachen?
- Wie sieht ein Bild der Figurenbeziehungen aus?
- Was ist der Kern der Szene?
- Wie sieht ein Bild der Szene aus?
- Welchen Subtext sprechen die Figuren? Welche nonverbale Sprache?
- Welche musikalische Gliederung, Impulse und Effekte hat die Szene?
Aufwärm- und Gruppenübungen
Musiktheater lebt von der Gruppendynamik und der Ausdrucksfähigkeit der Darstellenden. Wie kann in den Proben der Körper aufgewärmt und die Wahrnehmung geschult werden? Wie kann die Gruppe miteinander agieren? Wie kann die Improvisations- und Spielfreude angeregt werden?
Aufwärmübungen haben verschiedene Ziele: Das Bewusstsein in den Körper zu richten, den Körper zu aktivieren, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, Raum, Bühne und Mitspieler*innen wahrzunehmen, die Gruppe oder Einzelpersonen zu energetisieren, die die Artikulation zu schärfen aber auch zu improvisieren – sprachlich und körperlich.
Zunächst können der Raum und die Gruppe erkundet werden: Hier gehen alle durch den Raum, jede*r sucht sich einen bestimmten Punkt und geht zielstrebig aber ohne Kollisionen auf ihn zu. Auch können dabei alle auf ein Kommando der Leitung einfrieren und sich gegenseitig kurz betrachten, bevor es weitergeht.
Man kann dabei auch laut die Ziele oder Zielgegenstände im Raum benennen – Level 2 ist anschließend, die Gegenstände immer mit dem Namen des vorherigen Gegenstands zu benennen. So wird eine lustige und aktivierend Konzentrationsübung daraus.
Gehen durch den Raum kann auch verschiedensten Körperübungen dienen. Die Leitung gibt hier Kommandos, die die Art des Gehens bestimmen: Geschwindigkeiten werden durchgewechselt (z.B. sehr schnell bis Zeitlupe), bestimmte Körperteile können den Körper führen (z.B. Nase, Ellenbogen…). Diese Impulse kann die Gruppe nach einiger Zeit auch nonverbal selbst koordinieren, was die Wahrnehmung füreinander verstärkt. Auch Emotionen, Ausdrucksweisen, Tiere oder Figuren werden gehend erkundet (z.B. verärgert, beflügelt; wie ein Panther; wie ein alter Mensch…). In diesen Ausdrucksweisen können sich die Teilnehmenden bei Begegnungen nun auch auf »oooh« begrüßen.
Körperübungen für Einzelpersonen können das Nachspielen einer aktivierenden Übung oder Szene sein: z.B. einen Ball durch den ganzen Körper rollen lassen; Duschen gehen mit Hindernissen und Abrubbeln des ganzen Körpers; auf einem imaginären Seil laufen…
Paarübungen sind besonders gut, um Gruppen- und Körperbewusstsein zu stärken sowie Vertrauen zu entwickeln. Hier kann sich Rücken an Rücken bewegen, sich spiegeln oder sich führen: z.B. an den aufeinandergelegten Mittelfingerspitzen und die geführte Person hat die Augen geschlossen, über die Handfläche vor dem Gesicht der zweiten Person oder mit dem Oberkörper.
Gruppenspiele können dem Kennenlernen oder der Konzentration und Energie dienen. In »Call and Response«-Spielen übernehmen alle in einem Kreis einen Grundrhythmus. Nun spricht jede Person ihren Namen, macht eine Bewegung oder ein Geräusch. Alle anderen machen nach. So kann sich reihum jede*r vorstellen. Anschließend werden die Namensarten in verschiedenen Ausdrucksweisen variiert oder Personen von Mitspielenden aufgerufen.
Auch die Händeflüsterpost schult die Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit: Alle nehmen sich im Kreis an den Händen, einmal drücken gibt den Impuls weiter, zweimal drücken ändert die Richtung. Ähnlich funktioniert das das Whiskeymixer-Spiel: Alle stehen im Kreis und geben das Wort »Whiskeymixer« möglichst schnell herum. Sagt jemand »Messwechsel«, wird die Richtung gewechselt und nun das Wort »Wachsmaske« weitergegeben. Wer zögert, sich verspricht oder lacht (und das ist garantiert), muss einmal um den Kreis laufen.
Artikulationsübungen sind lustig und energetisierend: Wer kann den Zungenbrecher am schnellsten? Können wir Wörter erkennen, wenn sie mit einem Korken zwischen den Zähnen gesprochen werden?
Nun geht es ans Improvisieren, etwa im Gruppenspiel »Freeze«: Zwei Personen beginnen mit einer Szene, alle anderen sitzen im Kreis um sie herum. Sobald eine*r der Beobachtenden in der Körperhaltung der Spielenden eine neue Idee entdeckt, klatscht diese Person zweimal in die Hände und ruft »freeze!«. Die beiden Spielenden frieren ein, die Person löst eine spielende Person in derselben Körperhaltung ab und beginnt eine völlig neue Szene zu spielen.
Auch singend kann improvisiert werden: Alle singen ein bekanntes Lied, reihum wird nun je eine Zeile übernommen und neu gedichtet. Oder 2-4 Personen improvisieren gemeinsam: Jede*r bekommt eine kurze Textzeile (z.B. den Namen einer berühmten Person, ein Spruch aus der Werbung…). Nun beginnt Person 1 mit einem Rhythmuspattern auf ihren Wörtern, Person 2 übernimmt den Bass auf den eigenen Wörtern, Personen 3 und 4 steigen mit Melodien auf ihren Wörtern ein. Nach einiger Zeit können Abwandlungen und Soli stattfinden oder auch ein*e Dirigent*in dazukommen.
Impulsfragen
- Was soll im Raum erkundet werden?
- Wie kann der Körper aktiviert werden?
- Wie können Körperbewusstsein und Ausdrucksfähigkeit gestärkt werden?
- Wie kann sich die Gruppe verbinden?
- Wie viel trauen sich die Teilnehmenden schon?
- Wie ist gerade die Stimmung?
- Brauchen wir mehr Konzentration, mehr Vertrauen, mehr Energie, mehr Übung?
- Haben wir Lust auf singende Improvisation?
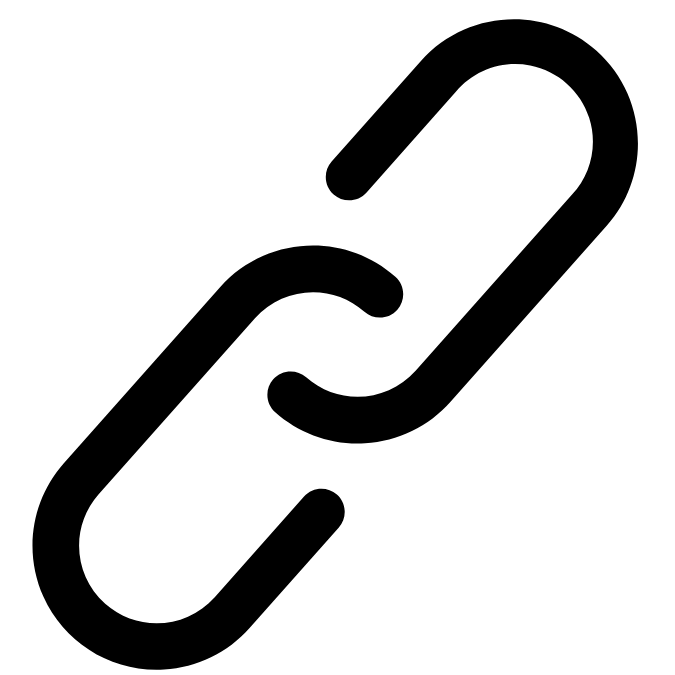
Mehr Ideen und Anregungen gibt es unter „Improtheater Wiki “
Digitale Medien für Proben und Aufführung
In der Vorbereitung und Umsetzung eines Singspiels oder eines Konzerts können viele digital-mediale Mittel genutzt werden. Welche Möglichkeiten gibt es für die Kommunikation, für Übedateien und die Aufführung? Wie können Teilnehmende schneller und eigenständiger lernen, um Präsenzproben einzusparen?
Um ein Singspiel oder Konzert vorzubereiten, können viele digital-mediale Mittel genutzt werden. Besonders hilfreich ist das, wenn durch Corona die Präsenz-Probenplanung nicht absehbar ist: So kann auch außerhalb der Probenzeit Organisatorisches geklärt werden sowie eine selbstständige Vorbereitung der Musiker*innen stattfinden. In den Präsenzproben können dann die Abläufe vor Ort sowie die musikalische Arbeit fokussiert werden. Digital-mediale Mittel können darüber hinaus auch in der Aufführung genutzt werden und das Konzert oder Musiktheater und seine Umsetzung bereichern.
Um die Kommunikation in der Probenarbeit zu erleichtern, ist es sinnvoll eine Plattform zu nutzen, auf der alles Wichtige gebündelt ist: Informationen, Ideen, Probenpläne, Einteilungen, Übedateien, Videos, Audios etc. Dafür eignen sich Kanban-Boards wie beispielsweise Padlet besonders gut. Hier können alle Mitglieder des Ensembles sich informieren und Dateien finden, aber auch selbst interagieren und Dateien einstellen (etwa ein Foto vom Stand des Kostüms) oder an einer Abstimmung zur Konzertanreise teilnehmen. Padlet kann von Kindern wie Erwachsenen bedient und in einem nicht-öffentlichen, auch passwortgeschützten Modus angelegt werden. Alternativ können Sie auch einen Cloud-Ordner teilen, etwa von Dropbox oder Google Docs.
Am besten auf einer übersichtlichen Plattform, aber auch ohne, können Sie musikalische Übedateien bereitstellen. Hier eignen sich vor allem Singalongs/Playalongs, zusätzlich aber auch Playbacks ohne die eigene Stimme, zu denen eigenständig gesungen/gespielt werden kann. Hierfür können Sie Audio-Bearbeitungsprogramme wie z.B. Garage Band, Walk Band oder BandLab nutzen und die einzeln aufgenommenen Stimmen ganz einfach zusammenstellen bzw. jeweils bestimmte Stimmen weglassen. Besonders bei auswendig aufgeführten Musicals und Konzerten kann so sehr schnell eine Sicherheit in Gesangstexten, Aussprache, Melodien und Einsätzen erreicht werden. Bei instrumentalen Ensembles entwickelt sich bei den Musizierenden dadurch schneller eine rhythmische Stabilität und eine Vorstellung des gesamten Stücks.
Außerdem lohnt es sich, Sprechtext-Übedateien bereitzustellen, etwa für Konzertmoderationen oder Liedtexte, aber insbesondere auch für Dialoge von Singspielen und Musicals. Gerade für Kinder, die sich beim Lesen noch schwertun, ist es hilfreich, Sprechtext zum Hören anzubieten. Hierfür kann beispielsweise das Textbuch szenenweise inklusive der Rollennamen vorgelesen werden. Wer möchte, kann aus diesen vorgelesenen Texten auch »Speakalongs« der Dialoge machen: Dazu werden in einem Audiobearbeitungsprogramm (z.B. Garage Band, Walk Band oder Band Lab) einfach alle Stellen der jeweiligen Rolle aus der Spur geschnitten. In diesen Pausen kann die Person nun beim Üben den Text ihrer Rolle sprechen. Die Sprechtexte können zusätzlich auch mit den Musicalsongs verbunden und/oder in Videos mit Entwürfen der Bühnenszenerie hinterlegt werden.
In Programmen wie z.B. Scratch kann mithilfe von vorgefertigten Figuren und Hintergründen digital bequem eine Bühnenszenerie entworfen werden, die dabei hilft, eine visuelle Vorstellung der Szene und Stückabläufen zu entwickeln. In den Proben haben die Teilnehmenden dann bereits eine räumliche Orientierung und kennen die groben Abläufe. Auch Probenvideos von Choreografien und Szenen können während des Projekts bereitgestellt und dadurch zu Hause noch einmal nachgesehen und Abläufe eigenständig geübt werden. Nicht nur den Darstellenden, sondern auch der Leitung bzw. regieführenden Person können diese Videos im Probenprozess helfen, den Überblick zu behalten.
Als Vorbereitung für eine Aufführung können auch Klänge gesammelt werden. Das kann eine Rechercheaufgabe für Kinder sein, aber auch Effekten im Stück oder der Erstellung einer Soundscape, einer »Klanglandschaft«, z.B. für den Einlass oder die Pause dienen. Dabei werden die einzelnen Aufnahmen zusammengefügt und überlagert. Als Soundscape kann beispielsweise Vogelgezwitscher die Atmosphäre schaffen für ein tierisches Singspiel in der Natur oder Meeresrauschen für ein Konzert mit Shantys. Für Effekte in Stücken oder Konzerten könnten z.B. Autogeräusche und Hupen eine Ankunft/Abfahrt symbolisieren, ein lautes Aushauchen ein gruseliges Geistergeräusch werden oder ein passendes Naturgeräusch das nächste Stück einleiten. Bei der Aufführung können diese Klänge nicht nur als Soundscapes und Effekte eingesetzt werden, sondern auch zur Interaktion dienen: So könnte das Publikum z.B. beim Einlass auf einem bereitstehenden Tablet einzelne Klänge an- und abwählen und dadurch die Soundscape individuell verändern (z.B. mit Garage Band/Walk Band oder Loopy HD).
Auch Projektionen sind in Aufführungen in vielen Bereichen sehr hilfreich. Meist benötigt man dazu nur einen Beamer, eine Leinwand bzw. einen Hintergrund und einen Laptop mit einem gängigen Präsentationsprogramm. Hier können Fotos, Videos, Audiodateien, Texte und Effekte zusammengestellt und live in der Aufführung weitergeklickt werden – sogar von der Bühne aus. Projektionen können zum einen ein aufwendiges Bühnenbild ersetzen (z.B. durch gemeinfreie Fotos aus Internetbibliotheken oder in Scratch erstellten Szenerien), aber auch Szenenwechsel ohne großen Umbau schnell verdeutlichen. Zum anderen können vorgefertigte Videos Einsicht in Chats/Briefeschreiben geben oder Szenen an anderen Orten (z.B. dem allseits bekannten Eiscafé am Ort, dem Badesee) mit einbeziehen. Auch das Publikum kann von den Projektionen profitieren: Etwa durch das Anzeigen von Übersetzungen fremdsprachiger Gesangstexte, Mitsingtexten, Mitspielnoten/-akkorden oder interaktiven Abstimmungen.
Impulsfragen
- Welche Aspekte von Probenarbeit gibt es in diesem Projekt?
- Was wäre hilfreich, dass eigenständig erarbeitet wird, um die Präsenzproben so selten und effektiv wie möglich stattfinden zu lassen?
- Welche Mittel können dabei helfen, schneller und eigenständig zu lernen?
- Wie können Informationen, Ideen und Probenhilfsmittel anschaulich gebündelt und kommuniziert werden? Wie können wir interagieren und uns darüber austauschen?
- Wie können Klänge und Projektionen dabei helfen, Szenerien und Handlungen darzustellen?
- Wie können mediale Mittel das Publikum mit einbeziehen?